
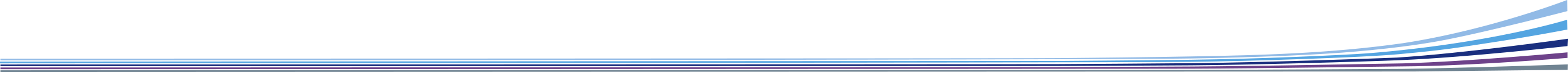

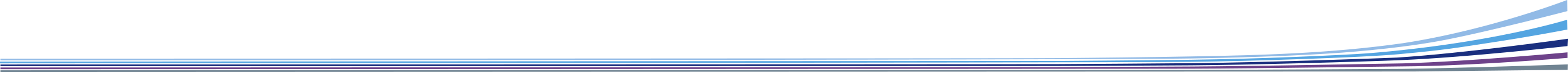
Verfasst von: Desitin Redaktionsteam
Diese Begriffe werden im Zusammenhang mit Morbus Parkinson häufig vereinfachend unter dem Begriff „Bradykinese“ zusammengefasst:
Die Symptome äußern sich jedoch strenggenommen unterschiedlich, obwohl viele auch unmittelbar zusammenhängen, da fast jeder Bewegungsablauf immer aus einem Mix aus Fein- und Grobmotorik, sowie bewusster (Willkürmotorik) und unbewusster Bewegung (Spontan- und Mitbewegungen) ist.
Die Bewegungsverlangsamung, Minderbewegung und Bewegungsarmut (Hypokinese, Bradykinese), bis hin zur vollständigen Blockade einer Bewegung (Akinese) ist ein schleichender Prozess und für viele Patientinnen und Patienten mit Morbus Parkinson der Aspekt ihrer Bewegungsstörungen, der sie am meisten einschränkt. Gleichzeitig sind sie auch die Symptome, die zu den gefährlichsten Komplikationen, wie etwa dem akinetischen Schock, führen könne, während ein Ruhe-Tremor vielen Patientinnen und Patienten zwar sehr unangenehm ist, aber an sich keine große Gefahr für die Gesundheit darstellt.

Informationen für Ärztinnen und Ärzte
Fachinformationen, Servicematerialien und
vieles mehr zum Thema Parkinson

Vielfältige Symptome bei Morbus Parkinson
Parkinson hat viele Symptome. Die meisten Menschen verbinden mit der Krankheit vor allem das typische Zittern. Aber im Frühstadium zeigt sich Morbus Parkinson oft nur durch subtile erste Anzeichen für gestörte Bewegungsabläufe. Außerdem müssen nicht alle Frühsymptome die Motorik betreffen.
Eines der ersten Parkinson-Symptome im Rahmen der Hypokinese zeigt sich z. B. an einem Arm, der beim Gehen nicht mehr so stark und häufig mitschwingt wie bei einem gesunden Menschen. Im Frühstadium tritt dieses Symptom vor allem einseitig auf, während es sich im fortgeschrittenen Stadium auf beide Körperseiten ausbreitet. Die Hypokinese kann übrigens auch die Bauchdecken- und Atemmuskulatur beeinträchtigen, ebenso wie den Verdauungstrakt und die Speiseröhre, was mitunter auch zu Verstopfungen, Schluckstörungen und Sprachstörungen führen kann.
Häufig nimmt auch die Mimik ab, wodurch im fortgeschrittenen Stadium beim Gesichtsausdruck der Eindruck entsteht, als würden die Patientinnen und Patienten „eine Maske tragen“ (Hypomimie / Amimie). Die Gesichtsmuskeln verlieren ihre Beweglichkeit. Die Augenlider schließen sich seltener, die Mundwinkel bleiben starr. Auch die Augenbewegung verringert sich. Angehörigen fällt es mit der Zeit immer schwerer, Emotionen im Gesicht abzulesen. Besonders problematisch: Betroffene wirken durch den regungslosen Gesichtsausdruck abwesend und teilnahmslos, obwohl sie es nicht sind.
Auch willkürliche große Bewegungen (Grobmotorik), wie beispielsweise Drehen, Gehen oder das Aufstehen vom Stuhl, nehmen im Bewegungsausmaß weniger Raum ein und können von Betroffenen nur noch schwer, und in vielen ungelenken und ruckartigen Zwischenschritten, ausgeführt werden. Die Folge: Alltagstätigkeiten fallen immer schwerer und dauern immer länger, zum Beispiel der morgendliche Gang zur Toilette, das Zähneputzen, Waschen und Anziehen, Spaziergänge oder auch nur das Aufstehen und Hinsetzen.
Denn einige Symptome der Hypokinese beziehen sich auch auf die Feinmotorik. Besonders bezeichnend ist die Handschrift, die mit der Zeit zittriger und kleiner wird (Mikrografie). Auch andere alltägliche Handlungen, die feine Fingerbewegungen erfordern, wie etwa das Schließen von Knöpfen oder das Öffnen einer Flasche, fallen zunehmend schwerer. Im Spätstadium wird bereits das bloße Halten eines Stiftes oder das Tippen auf der Tastatur zur Herausforderung.
Der Grund: Es handelt sich bei Morbus Parkinson um eine Störung des extrapyramidalen Systems. Dieses ist zwar nicht direkt für die Feinmotorik zuständig, sondern für grobmotorische Massenbewegungen des Rumpfs und der Extremitäten. Doch damit schafft es die Grundlage für die willkürlichen und feinmotorischen Bewegungsabläufe, welche durch die Pyramidenbahnen initiiert werden.
Anders ausgedrückt: Jede willkürliche und feinmotorische Bewegung, welche durch die Pyramidenbahnen eingeleitet wird, erfordert stets auch eine grobmotorische Massenbewegung der proximalen (zum Rumpf hin, zur Körpermitte hin, am Ansatz gelegen) Rumpf- und Extremitätenmuskulatur. Um zum Beispiel die Hand beim Schreiben zu bewegen, oder die Finger, um Hemdknöpfe zu schließen oder Schuhe zu binden (Pyramidenbahnen), muss auch der Oberarm bewegt werden (extrapyramidales System).
Gleichzeitig wird durch die Hypokinese der individuelle Gang kleinschrittig und unsicher. Das Anheben der Füße fällt Betroffenen sehr schwer. Die Körperhaltung beim Gehen und Stehen ist gebeugt (Knie und Ellenbogen angewinkelt, der Oberkörper nach vorne gebeugt). Auf die typische gebeugte Haltung hat jedoch vermutlich auch der Rigor Einfluss, also die dauerhafte und schmerzhafte Anspannung der Muskeln. Es sind zudem viele Zwischenschritte erforderlich, um eine Wendebewegung durchzuführen. Denn die gestörten Halte- und Stellreflexe führen dazu, dass spontane Ausgleichsbewegungen zu Gegenbewegungen zum Ausbalancieren des Körpers erschwert oder unmöglich werden, wodurch es zu Gleichgewichtsproblemen kommt und die Sturzgefahr steigt.
Symptome im Überblick:
Von der Akinese spricht man, wenn es zu Phasen vollständiger Bewegungslosigkeit bzw. Blockaden von Spontan- und Mitbewegungen der Skelettmuskulatur kommt (oder auch in der Herzmuskulatur). Sowohl unwillkürliche als auch spontane Bewegungsabläufe gehen dadurch zum Teil vollständig verloren. Menschen mit Parkinson können (temporär) gar nicht mehr aufstehen oder sprechen. Zielgerichtetes Einleiten oder Beenden von Bewegungen fällt enorm schwer.
Das führt mitunter auch zum Freezing. Dieses beschreibt Probleme beim Einleiten einer Bewegung, vor allem beim Losgehen, Aufstehen, Drehen und Hinsetzen. Andere Patientinnen und Patienten können hingegen Probleme beim spontanen Beenden einer Bewegung haben, um beispielsweise auf ein plötzlich auftretendes Hindernis beim Gehen zu reagieren (motorische Gebundenheit). Die Akinese beschreibt mit Bezug auf Morbus Parkinson sozusagen die schwerste Form der Hypokinese.
Es kann im Endstadium auch zu Komplikationen kommen wie der akinetischen Krise. Betroffene können sich plötzlich gar nicht mehr bewegen und beginnen außerdem stark zu schwitzen, oder der Blutdruck und die Herzfrequenz steigen an. In diesem Fall müssen Betroffene sofort in einem Krankenhaus behandelt werden. Sie kann plötzlich einsetzen, sich aber auch innerhalb von einigen Tagen stückweise aufbauen. Die Blockade kann sich auch auf das Kauen und Schlucken auswirken, sodass Betroffene plötzlich gar nicht mehr Essen und Trinken können. Das führt häufig zu Begleitkomplikationen, wie akutem Flüssigkeitsverlust, weil es nicht mehr möglich ist, etwas zu trinken.
Akinese-Symptome im Überblick:
Hypokinese und Akinese können auch den Verdauungstrakt betreffen, primär die Peristaltik von Darm und Speiseröhre. Dies kann im Frühstadium zu hartnäckigen Verstopfungen führen. Zudem führen im weiteren Verlauf Schluckstörungen zu vermehrtem Speichel und Schwierigkeiten beim Essen. Betroffene verschlucken sich häufig und Speichel kann aus dem Mund austreten. Auch die an der Sprach- und Stimmbildung beteiligten Muskeln können beeinträchtigt werden. Die Stimme wird nicht nur leiser, rauer, zittriger oder höher, sondern nimmt auch eine monotone Färbung an (Dysarthrophonie). Die Sprache wird oftmals undeutlicher. Der verlangsamte und von langen und plötzlichen Pausen geprägte Sprachrythmus, sowie der gestörte Sprachfluss, sind hingegen eher Symptome der Bradykinese. Insgesamt können also alle Muskeln, die direkt an das Skelett angrenzen, sowie die Bauchdeckenmuskulatur, Atemmuskulatur und Gesichtsmuskulatur, durch die Akinese und Hypokinese beeinträchtigt werden.
Unter dem Begriff Bradykinese (Minderbewegung, verlangsamte Bewegung) versteht man die allgemeine Verlangsamung willkürlicher Bewegungsabläufe. Das Gehen verlangsamt sich stark, ebenso wie sämtliche feinmotorische Abläufe. Auch die Gestik verringert sich deutlich und der Sprachrhythmus verändert sich. Doch diese verlangsamten und veränderten Bewegungsabläufe sind zum Teil auf Akinese und Hypokinese zurückzuführen. Willkürliche Bewegungen werden auch durch die Störung unwillkürlicher Spontan- und Mitbewegungen verlangsamt und erschwert.
Symptome im Überblick:
Die Förderung Ihrer Beweglichkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Parkinson-Therapie. Die folgenden Übungen helfen Ihnen, Ihre Fingerfertigkeit und Ihren Gesichtsausdruck zu trainieren. Bereits wenige Minuten pro Tag genügen. Mit jeder Übung arbeiten Sie an Ihrer Selbständigkeit und trainieren Ihr Geschick.
Sie können viel dazu beitragen, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Machen Sie mit!
Weitere Übungen bei Parkinson als Broschüre:

Diese speziellen Parkinson-Übungen hat Desitin zusammen mit Herrn Prof. Dr. med. Georg Ebersbach entwickelt. Die Übungen sollen Menschen mit Parkinson helfen, so lange wie möglich beweglich und aktiv im täglichen Leben zu bleiben.
Das Desitin Redaktionsteam besteht aus den Bereichen Medical Affairs und Product Management. Um Ihnen die besten Inhalte zu bieten, arbeiten wir zusätzlich mit Expertinnen und Experten zusammen. Das Team wird um ausgewählte Ärztinnen und Ärzte sowie Fachjournalistinnen und Fachjournalisten ergänzt. Diese schreiben regelmäßig für uns und bereichern desitin.de mit ihren fachlichen Beiträgen. Schreiben Sie uns bei Fragen auch gerne eine E-Mail an info@desitin.de.
1 ParkinsonFonds Deutschland. Ist Parkinson eine Erbkrankheit? https://www.parkinsonfonds.de/uber-parkinson/arten-von-parkinson/erblicher-parkinson/. Abgerufen am 12.10.2021.
2 Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V., 2020. Interview mit Prof. Gasser zum Welt-Parkinson-Tag: „Klären Sie so frühzeitig wie möglich die Symptome ab“. https://www.dzne.de/im-fokus/meldungen/2020/interview-mit-prof-gasser-zum-welt-parkinson-tag-klaeren-sie-so-fruehzeitig-wie-moeglich-die-symptome-ab/. Abgerufen am 12.10.2021.
3 Deutsche Parkinson Gesellschaft e. V. 2020. Hintergrundinformationen Parkinson-Krankheit https://www.parkinson-gesellschaft.de/die-dpg/morbus-parkinson.html. Abgerufen am 12.10.2021.
4 GBD 2016 Parkinson’s Disease Collaborators. Global, regional, and national burden of Parkinson’s disease, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2018 Oct 1. pii: S1474-4422(18)30295-3. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30295-3.
5 Höglinger GU (Hrg.). Parkinson-Syndrome kompakt, Thieme, Stuttgart, 2018.
6 Schweizerische Parkinsonvereinigung. Was ist Parkinson? https://www.parkinson.ch/index.php?id=181. Abgerufen am 12.10.2021.
7 Care Companion. Parkinson: Diagnose, Verlauf & Lebenserwartung. https://www.careship.de/senioren-ratgeber/parkinson/. Abgerufen am 12.10.2021.
8 Zhao, Y. J., Wee, H. L., Chan, Y. H., Seah, S. H., Au, W. L., Lau, P. N., ... & Tan, L. C. (2010). Progression of Parkinson's disease as evaluated by Hoehn and Yahr stage transition times. Movement Disorders, 25(6), 710-716. https://doi.org/10.1002/mds.22875
9 Divac, N., Stojanović, R., Savić Vujović, K., Medić, B., Damjanović, A., & Prostran, M. (2016). The efficacy and safety of antipsychotic medications in the treatment of psychosis in patients with Parkinson’s disease. Behavioural neurology, 2016. doi: 10.1155/2016/4938154
10 Aarsland, D., & Kurz, M. W. (2010). The epidemiology of dementia associated with Parkinson's disease. Brain pathology, 20(3), 633-639. https://doi.org/10.1111/j.1750-3639.2009.00369.x
11 Stiftung MyHandicap. Die Lebenserwartung mit Parkinson. https://www.myhandicap.de/gesundheit/koerperliche-behinderung/parkinson/lebenserwartung/. Abgerufen am 12.10.2021.
12 Horsager, J., Andersen, K. B., Knudsen, K., Skjærbæk, C., Fedorova, T. D., Okkels, N., Schaeffer, E., Bonkat, S. K., Geday, J., Otto, M., Sommerauer, M., Danielsen, E. H., Bech, E., Kraft, J., Munk, O. L., Hansen, S. D., Pavese, N., Göder, R., Brooks, D. J., Berg, D., Borghammer, P. (2020), Brain-first versus body-first Parkinson's disease: a multimodal imaging case-control study, DOI: 10.1093/brain/awaa238
13 Barone, P., Scarzella, L., Marconi, R. et al. Pramipexole versus sertraline in the treatment of depression in Parkinson’s disease. J Neurol 253, 601–607 (2006). https://doi.org/10.1007/s00415-006-0067-5
14 DGN (2016). Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Leitlinien fur Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Idiopathisches Parkinson-Syndrom. Entwicklungsstufe S3. Stand: 01.01.2016 https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-010k_S3_Parkinson_Syndrome_Idiopathisch_2016-06-abgelaufen.pdf. Abgerufen am 12.10.2021.
Mehr für Parkinson-Patientinnen und Patienten
Um den Alltag als Patient/in bzw. Angehörige/r zu erleichtern,
bieten wir Ihnen umfangreiche Informationen.
INFOMATERIAL
Broschüren & Downloads
PRODUKTE
Übersicht & Informationen
ZENTREN FINDER
Hilfe in Ihrer Nähe
WISSENSWERTES
Informationen zur Erkrankung