
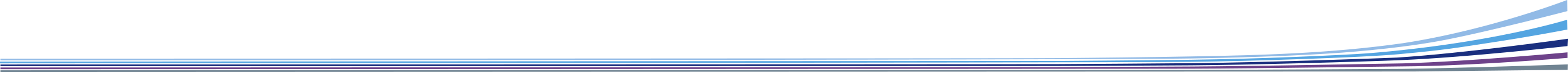

Informationen über Antiepileptika, Operations-
möglichkeiten und Ketogene Ernährung
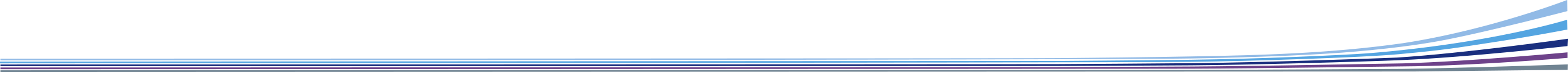
Verfasst von: Desitin Redaktionsteam
Ist eine Epilepsie diagnostiziert und die Form der epileptischen Anfälle genau charakterisiert, kann eine passende Therapie angewandt werden. Diese beginnt meist mit Medikamenten (Antiepileptika / Antikonvulsiva), mit deren Hilfe etwa zwei von drei Patientinnen und Patienten anfallsfrei werden. Allerdings müssen die Medikamente dafür häufig über Jahre, oder sogar ein Leben lang eingenommen werden. Zudem wirken die verschiedenen Wirkstoffe nicht bei allen Betroffenen gleichermaßen und gehen oft mit unterschiedlichsten Nebenwirkungen einher.
Die genaue Auswahl und Einstellung der Medikation kann deshalb oft Monate oder sogar Jahre dauern und erfordert regelmäßige Untersuchungen und vor allem ein großes Vertrauen zwischen Angehörigen, Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten. Stellt sich allerdings nach mindestens einem Jahr, unter maximal möglicher Dosierung und der Verabreichung von mindestens zwei unterschiedlichen Antiepileptika (entweder in Mono- oder Kombinationstherapie) noch immer kein Behandlungserfolg ein, also eine Verbesserung des Anfallsgeschehens, handelt es sich eventuell um eine pharmakoresistente Epilepsie (Epilepsie spricht nicht auf Medikamente an).
Dann gibt es weitere Optionen. In diesem Fall können unter Umständen andere Behandlungsmöglichkeiten greifen, zum Beispiel die Epilepsiechirurgie und Neurostimulation (Vagusnervstimulation). Doch zunächst geht es darum, die medikamentöse Therapie zu optimieren und mit verschiedensten Maßnahmen zu unterstützen. So können zum Beispiel auch eine Umstellung der Ernährung (ketogene Ernährungstherapie), Psychotherapie, Neuropsychologie und gezielten Anfallsunterbrechung zur Verbesserung des Anfallsgeschehens beitragen.
Neben der Ursache der Epilepsie werden auch die Anfallsform, zusätzlich bestehende Krankheiten und weitere medizinische Befunde zur Diagnose und Auswahl der richtigen Medikamente bzw. Behandlungsmöglichkeit herangezogen. So wirken manche Medikamente zum Beispiel nur bei bestimmten Epilepsie-Syndromen, während die Epilepsiechirurgie häufig nur bei fokalen Epilepsien anwendbar ist. Auch das Alter des Betroffenen bei Krankheitsbeginn spielt eine sehr wichtige Rolle.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Für die Behandlung von Epilepsien stehen heute zahlreiche Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Die bekannteste Therapie ist die Einnahme von Medikamenten, den Antiepileptika. Doch auch Operationen wie die Vagusnerv-Stimulation (Neurostimulation) stehen zur Verfügung, ebenso wie die ketogene Ernährungstherapie (KET). Welche Therapie für die jeweiligen Patientinnen und Patienten geeignet ist, hängt vor allem vom individuellen Krankheitsbild, der Anfallsform und den damit verbundenen Besonderheiten ab. Die Prognose variiert dabei je nach Form der Epilepsie stark. Fest steht aber, dass eine Epilepsie fast immer behandelt werden muss.
Obwohl es gelegentlich vorkommt, dass eine Epilepsie ohne Therapie ausheilt, ist in der Regel eine Behandlung erforderlich. Die weitläufige Meinung, mit der Pubertät oder nach einer Schwangerschaft verliere sich die Krankheit ohnehin, erweist sich meist als unzutreffend.
Aus folgenden Gründen ist die Behandlung der Anfälle notwendig:
Die - mit Abstand - wichtigste Behandlungsmethode besteht in der Gabe von Medikamenten, welche die abnorme Reizbarkeit der Nervenzellen, die zu epileptischen Anfällen führen, herabsetzen und so ihre Anfallsbereitschaft vermindern. Nur Ärztinnen und Ärzte können entscheiden, welche Medikamente und welche Dosis angebracht sind. Eine „Patentmedizin“, die bei allen Patientinnen und Patienten die Anfälle beseitigt, gibt es nicht.
Allerdings gibt es auch Situationen, in denen die Gabe von Medikamenten nicht sinnvoll bzw. sofort empfehlenswert ist. So kann es nämlich auch durchaus zu einmaligen Anfällen kommen, die keine sofortige Behandlung erforderlich machen. Deshalb gibt es, neben der Diagnose via EEG, einige Fragen, welche die Ärztinnen und Ärzte mit Angehörigen und Patientinnen und Patienten besprechen, wenn es erstmalig zu einem Anfall kommt.
Folgende Dinge werden vor der erstmaligen Medikation untersucht:
So kann es durchaus sein, dass nicht jeder erstmalige Anfall sofort behandelt, jedoch auf jeden Fall untersucht werden muss.

Informationen für Ärztinnen und Ärzte
Fachinformationen, Servicematerialien
und vieles mehr zum Thema Epilepsie
Das Ziel der Behandlung ist völlige Ausheilung der Epilepsie. Es ist dann erreicht, wenn auch ohne Medikamente keine Anfälle mehr auftreten. Aber auch Anfallsfreiheit mit Medikamenten ist ein ausgezeichnetes Ergebnis.
Bei richtiger Anwendung der heute zur Verfügung stehenden Mittel sehen die statistischen Behandlungserfolge folgendermaßen aus:
Etwa 50 % aller Epilepsie-Patientinnen und Patienten werden mit dem ersten verabreichten Medikament anfallsfrei.
Bei den übrigen 50 % wird meist ein weiteres antiepileptisches Medikament verschrieben, worunter durchschnittlich weitere 20% anfallsfrei werden.
Die Patientinnen und Patienten, die weitere Anfälle erleiden, werden häufig mit einer Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen behandelt (Kombinationstherapie). Bei der medikamentösen Behandlung der Epilepsie ist es besonders wichtig, dass die Antiepileptika regelmäßig und zu festen Zeiten eingenommen werden. Nur so wird die bestmögliche Wirksamkeit erreicht.
In den letzten Jahren ist unser Wissen über epileptische Anfälle und Epilepsien deutlich angewachsen, so sind auch neue Medikamente gefunden bzw. gezielt entwickelt worden. Es ist davon auszugehen, dass es auch in den nächsten Jahren gelingen wird, unsere Erkenntnisse über die Epilepsien zu erweitern. So dürfen auch diejenigen hoffen, denen bis heute noch nicht oder nur ungenügend geholfen werden kann.
Hinzu kommt, dass von den Patientinnen und Patienten, bei denen mit Medikamenten keine befriedigende Hilfe möglich ist, heute bereits knapp 10 % einem epilepsiechirurgischen Eingriff zugeführt werden können; die Erfolgsaussichten eines solchen Eingriffs liegen dabei – je nach Epilepsieform und Operationsverfahren – zwischen 50 − 80 %.
Geben Sie die Postleitzahl Ihres Wohnortes ein, um Epilepsie-Zentren in Ihrer Nähe zu finden.
Finden Sie Epilepsie-Zentren in Ihrer Nähe:
Die Behandlung von Epilepsie zielt nicht nur auf die Kontrolle epileptischer Anfälle ab, sondern berücksichtigt den gesamten Menschen in seiner individuellen Lebenssituation. Es geht darum, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern und ihnen trotz der Erkrankung ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Dabei stehen nicht nur medizinische Aspekte im Vordergrund, sondern auch psychologische, soziale und emotionale Faktoren. Die Epilepsie wird als Systemerkrankung betrachtet, die nicht nur Anfälle verursacht, sondern auch andere Bereiche des Lebens beeinflussen kann. Daher ist ein ganzheitlicher, interdisziplinärer Ansatz in der Behandlung essentiell. Ziel ist es, die Betroffenen und ihre Angehörigen zu stärken, Ängste zu reduzieren und ihm zu helfen, mit der Erkrankung umzugehen, sodass sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können.
Die Beziehung zwischen Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten ist zentral. Es geht nicht nur darum, eine Krankheit zu behandeln, sondern einen Menschen in einer bestimmten Lebensphase mit all seinen Ängsten, Hoffnungen und Wünschen. Menschen sind keine bloßen Objekte der Medizin, sondern aktive Teilnehmer im Dialog.
Das Hauptziel der Therapie ist es, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Anfallsfreiheit ist oft ein Schlüssel dazu, aber nicht das einzige Ziel. Manchmal kann sogar eine Bereitschaft vorhanden sein, einige wenige Anfälle zu akzeptieren, um die eigene Lebensqualität nach selbstbestimmten Vorstellungen zu leben.
Es ist wichtig, je nach Anfallsform, Ausprägung, Epilepsie-Syndrom und bisherigem Behandlungserfolg, verschiedene therapeutische Ansätze zu integrieren, von Medikamenten, über psychologische und soziale Maßnahmen, bis hin zu chirurgischen Eingriffen (sofern es sich um eine pharmakoresistente Epilepsie handelt). Eine solche Integration erfordert auch die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen, der Angehörigen, Arbeitskolleg*innen bzw. Lehrer*innen und Freunde.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Zur Behandlung steht eine Vielzahl von Wirkstoffen zur Verfügung, jedoch wirken nicht alle Medikamente bei allen Epilepsie-Formen. Es gibt Präparate, die nur bei fokalen Anfällen wirksam sind und andere, die insbesondere bei generalisierten Anfällen wirken. Wieder andere wirken bei beiden Anfallsformen oder nur bei ganz bestimmten Epilepsie-Syndromen. Bisweilen kann es viele Wochen oder gar Monate dauern, bis die Ärztinnen und Ärzte die richtige Kombination und Dosierung der Medikamente gefunden haben.
Um das wirksamste und verträglichste Antiepileptikum für Betroffene zu finden, müssen bei der Wahl des Präparats weitere Faktoren, wie z. B. das Alter der Patientinnen und Patienten, Allergien und eventuell weitere eingenommene Arzneimittel, berücksichtigt werden.
Auswahlkriterien für Antiepileptika/Antikonvulsiva:
Es gibt eine Vielzahl von Wirkstoffen, die je nach Verträglichkeiten, Alter und Form der Epilepsie als Mono- oder Kombinationsbehandlung verabreicht werden können. Hiervon zu unterscheiden sind noch die Medikamente für die Notfallmedikation.
Gängige Substanzen bei Epilepsie sind z. B.:
DESITIN hat fast alle diese Substanzen und noch weitere, im Sortiment und stellt die verschiedenen Medikamente daraus fast alle in Hamburg bzw. Deutschland her.
Die verwendeten Antiepileptika und Medikamente werden immer in enger Abstimmung mit Arzt oder Ärztin gewählt. Mittel wie Valproat werden jedoch häufiger als andere für die Behandlung idiopathischer generalisierter Epilepsiesyndrome verschrieben, während z. B. Ethosuximid vor allem bei Absencen im Schulkindalter verwendet wird, da es besser verträglich ist. Da es aber noch weitaus mehr Faktoren bei der Auswahl zu berücksichtigen gilt, ist das vertrauensvolle Verhältnis zwischen behandelndem Ärztinnen und Ärzte und Patient*in sehr wichtig. Es gibt noch weitere Therapie-Ansätze, z. B. bei der Behandlung des West-Syndroms (auch BNS-Epilepsie), bei der Hormone wie ACTH und Glucocorticoide zum Einsatz kommen.
An der Verarbeitung von Informationen im Gehirn sind Botenstoffe (Neurotransmitter) beteiligt. Sie sorgen dafür, dass Informationen von einer Nervenzelle zur anderen weitergegeben werden. Im Gehirn gibt es verschiedene Arten von Neurotransmittern, die sich alle in einem Gleichgewicht zueinander befinden. Wird dieses Gleichgewicht gestört, reagieren die Nervenzellen mit einer gesteigerten Erregbarkeit und es kann (z. B. durch eine Entzündung, Kopfverletzungen, hormonelle Schwankungen oder andere Auslöser) zu einem epileptischen Anfall kommen. Fast alle Antiepileptika bewirken das Aufrechterhalten bzw. Wiederherstellen dieses Gleichgewichts. Das ist allerdings nur möglich, solange eine bestimmte Menge des Wirkstoffs im Blut vorhanden ist. Sinkt der Medikamentenspiegel im Blut unter eine bestimmte für jeden Betroffenen individuell zu bestimmende Schwelle, wirkt das Präparat nicht. Daher ist es unbedingt notwendig, den Medikamentenspiegel dauerhaft auf einem bestimmten Niveau zu halten, was nur durch eine regelmäßige Einnahme der Medikamente gewährleistet werden kann.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Neben den bereits genannten Faktoren wie Alter, Vor- und Begleiterkrankungen und EEG-Befunden der Patientinnen und Patienten spielt vor allem die konkrete Anfallsform eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Antiepileptika.
Das „Gewitter im Gehirn“ betrifft entweder Teilbereiche des Gehirns (fokale Epilepsie) oder das gesamte Gehirn (generalisierte Epilepsie). Bestimmte Abläufe, Häufigkeiten und Symptome werden zu sogenannten Epilepsie-Syndromen zusammengefasst, etwa der Juvenilen Absence-Epilepsie, dem Dravet-Syndrom oder der Rolando-Epilepsie. Zudem ist nicht jeder einmalige Krampfanfall gleichbedeutend mit einer Epilepsie. Im Kindesalter ist die Prognose außerdem sehr gut, sodass nicht jeder einmalige Anfall sofort zu einer dauerhaften Therapie führen muss. Die Prognose bezüglich Anfallsfreiheit variiert jedoch stark.
Wichtig ist auch, dass die nachfolgenden Informationen lediglich einen Überblick ermöglichen, aber keinesfalls die individuelle ärztliche Beratung und Verordnung ersetzen sollen.
Einige der häufigsten Arten generalisierter Epilepsien sind:
Bei Vorliegen einer dieser Epilepsiearten werden können zum Beispiel folgende Medikamente verordnet werden:
In Deutschland sind diese Medikamente für die Therapie von generalisierten Epilepsien zugelassen. Sie können entweder alleine (Monotherapie) oder in Kombination (Kombinationstherapie) verabreicht werden. Andere zugelassene Medikamente sind Phenobarbital und Primidon, die jedoch unter anderem aufgrund einiger Nebenwirkungen seltener zum Einsatz kommen und eher als Alternative eingesetzt werden, etwa bei bestehenden Arzneimittelallergien.
Die nachfolgende Übersicht zeigt einige Medikamente, die in Deutschland für die Therapie von fokalen Epilepsien zugelassen sind.
Die Wirksamkeit der genannten Medikamente ist meist ähnlich, jedoch können Unterschiede in der Verträglichkeit und Handhabung bestehen. Daher basiert die Therapie oft auf praktischen Überlegungen, Erkenntnissen aus der Diagnose der Anfallsform, z.B. aus EEG- Untersuchungen und bereits gemachten Erfahrungen, sowohl der Patientinnen und Patienten als auch der Ärztinnen und Ärzte.
Gemäß den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und zusätzlichen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie (DGfE) werden zwei Medikamente, Lamotrigin und Levetiracetam, für die Ersttherapie bei neu diagnostizierter fokaler Epilepsie empfohlen. Diese Empfehlungen basieren unter anderem auf der SANAD II Studie. Andere Medikamente haben individuelle Nachteile, etwa bestimmte Wechselwirkungen, Kontraindikationen oder vermehrte bzw. spezielle Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Schwindel, Sprachstörungen, Gewichtszunahme, Zittern oder Haarausfall, können aber in bestimmten Fällen als erste Wahl in Betracht gezogen werden. Das gilt zum Beispiel für Carbamazepin, Gabapentin, Oxcarbazepin, Topiramat, Valproat und Zonisamid.
Ein zentraler Aspekt ist, ob die Epilepsie mit einem oder mehreren Medikamenten behandelt werden sollte. In der Regel wird mit einer Monotherapie begonnen. Wenn diese nicht erfolgreich ist, kann eine zweite Monotherapie oder auch bereits eine Kombinationstherapie in Erwägung gezogen werden. Es gibt dabei einige Dinge zu beachten.
Monotherapie: Ein Medikament, klare Vorteile
Die Monotherapie, bei der nur ein Antikonvulsivum eingesetzt wird, ist in der Regel der erste Schritt in der Behandlung von Epilepsie. Der Vorteil dieser Methode liegt in ihrer Einfachheit: Es gibt eine klare Übersicht über Wirksamkeit und Nebenwirkungen, und die Medikamenten-Compliance der Patientinnen und Patienten ist am höchsten. Bei Epilepsien fokalen Ursprungs sind beispielsweise Carbamazepin, Lamotrigin, Levetiracetam, Topiramat und Valproinsäure Mittel der ersten Wahl. Für idiopathisch generalisierte Epilepsien werden zum Beispiel Valproinsäure, Topiramat und Lamotrigin oft bevorzugt.
Kombinationstherapie: Mehrere Wirkmechanismen, höhere Komplexität
Die Kombinationstherapie kommt ins Spiel, wenn die Monotherapie nicht den gewünschten Erfolg bringt. Hier werden zwei oder mehr Antikonvulsiva kombiniert, um verschiedene, sich ergänzende Wirkmechanismen zu nutzen. Dies kann die Wirksamkeit der Behandlung erhöhen. Allerdings bringt die Kombinationstherapie auch Herausforderungen mit sich: Es können vermehrt Nebenwirkungen auftreten, und es müssen Interaktionen zwischen den verschiedenen Medikamenten berücksichtigt werden.
Wie findet man den richtigen Weg?
Die Entscheidung zwischen Mono- und Kombinationstherapie sollte immer individuell getroffen werden, basierend auf dem klinischen Bild der Patientinnen und Patienten, den bisherigen Therapieerfahrungen und den potenziellen Nebenwirkungen der Medikamente. Es ist wichtig, dass Patientinnen und Patienten und Ärzte eng zusammenarbeiten und den Therapieansatz regelmäßig überprüfen.
Zusammengefasst:
Oberstes Ziel einer jeden antiepileptischen Therapie muss Anfallsfreiheit oder doch wenigstens Anfallskontrolle sein und zwar mit möglichst geringen Nebenwirkungen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde sind die Verhaltensbeobachtungen von Angehörigen oder Betreuern von besonderer Bedeutung.
Es gibt beträchtliche Unterschiede in Bezug auf das Risiko für Nebenwirkungen. So sind bei Phenobarbital oder Primidon sehr viel häufiger negative Auswirkungen zu erwarten als bei Carbamazepin oder Valproat. Einige Antiepileptika, wie z. B. Lamotrigin und Levetiracetam, zeichnen sich durch deutlich seltener auftretende kognitive Nebenwirkungen aus. Das Risiko steigt auch mit der Anzahl der Medikamente, die eine Therapie umfasst. Entsprechend bergen Kombinationstherapien ein deutlich höheres Risiko. Kombinationstherapien sind aber gerade bei Patientinnen und Patienten mit schwer behandelbaren Epilepsien die Regel. Dies bedeutet, dass es häufig nur das Ziel ist, Nebenwirkungen in ihrem Einfluss auf Erleben und Verhalten zu begrenzen, völlig auszuschließen sind sie jedoch meist nicht. Was für Betroffene tolerabel ist, kann in der Regel nur individuell im ausführlichen Austausch zwischen Patient*in und medizinischem bzw. psychologischem Fachpersonal abgeklärt werden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Bei meist guter Verträglichkeit und jahrelanger Anfallsfreiheit fällt es manchen Patientinnen und Patienten schwer, jeden Tag an die Einnahme der Tabletten zu denken. Schließlich geht es dem/der Patient*in ja scheinbar „gut“. Trotzdem ist es notwendig, die Medikamente regelmäßig einzunehmen, um den notwendigen Medikamentenspiegel weiter aufrechtzuerhalten und die Anfallsfreiheit oder eine niedrige Anfallsfrequenz zu sichern.
Nur unter bestimmten Umständen kann es funktionieren, die Medikamente abzusetzen. Dies sollte immer gemeinsam mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzte besprochen und entschieden werden. In keinem Fall sollten Patientinnen und Patienten eigenmächtig die Medikamente absetzen. Unabhängig davon ist es im Verlauf der Therapie sehr wichtig, im Gespräch zu bleiben und aufkommende Fragen und Bedenken offen zu besprechen. Weitere Informationen bekommen Sie in unserer Broschüre „Epilepsie und Therapietreue“ zum Download.
Was kann bei unregelmäßiger Einnahme passieren?
Wenn Medikamente nur unregelmäßig eingenommen werden, kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass erneut Anfälle auftreten oder sich die Anfallssituation verschlechtert. Dies kann z. B. zum Entzug der Fahrerlaubnis führen, sofern zuvor eine längere Anfallsfreiheit bestand. Auch die Gefahr eines Status epilepticus erhöht sich, wenn die Einnahme nicht regelmäßig erfolgt.
Eine eigenmächtige Änderung der Einnahmezeitpunkte oder die Einnahme mit bestimmten Nahrungsmitteln kann den Therapieerfolg ebenfalls gefährden. Manche Medikamente können z. B. nur bei Einnahme in Verbindung mit einer Mahlzeit richtig wirken. Wieder andere Medikamente dürfen nicht zusammen mit bestimmten Nahrungsmitteln, wie z. B. Grapefruitsaft, eingenommen werden. Auch einige (rezeptfreie) Wirkstoffe (z. B. Johanniskraut) können dafür sorgen, dass der Spiegel des Epilepsie-Medikamentes im Blut absinkt.
Die Medikamente müssen meist über mehrere Jahre hinweg täglich regelmäßig eingenommen werden – und zwar auch dann, wenn aufgrund der Behandlung keine Anfälle mehr auftreten. Plötzliches Weglassen der Tabletten kann zu lebensbedrohlichen Anfällen führen und die Ausheilung verhindern. Nur Neurologinnen und Neurologen vermögen zu entscheiden, wann und ob die Tablettengabe ohne Gefahr langsam (d. h. über Monate hinweg) beendet werden kann.
PDF zur Therapietreue bei Epilepsie
Wichtige Informationen zur regelmäßigen Medikamenteneinnahme bei Epilepsie
Autor: Desitin Arzneimittel GmbH
Wie bereits erwähnt, kann die Auswahl und Einstellung der individuell passenden Antiepileptika teils Monate dauern. Ist die richtige Medikation einmal gefunden ist es unerlässlich, dass diese auch konsequent eingehalten wird. Deshalb ist es wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte beim Ausstellen des Rezeptes das Kreuz bei "Aut idem" setzen.
Die "Aut idem"-Regelung, die 2002 eingeführt wurde, ermöglichte den Apothekern in Deutschland, wirkstoffgleiche Arzneimittel durch kostengünstigere Alternativen zu ersetzen, um die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung zu reduzieren. Dies sollte jedoch die Therapiefreiheit der Ärztinnen und Ärztenicht beeinträchtigen. Die Regelung besagt, dass Apotheker ein Medikament durch ein preiswerteres ersetzen können, es sei denn, der Arzt oder die Ärztin hat dies auf dem Rezeptformular ausgeschlossen oder nur den Wirkstoff, aber keinen Präparatenamen angegeben.
Obwohl diese Regelung in vielen Fällen sinnvoll ist, gibt es Ausnahmen, insbesondere bei Antiepileptika. Die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft hat bereits bei der Einführung der "Aut idem"-Regelung darauf hingewiesen, dass ein Austausch von Antiepileptika in Apotheken negative Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten haben kann. Dies liegt an der besonders engen therapeutischen Breite dieser Medikamente. Studien haben gezeigt, dass jene Betroffene, die häufig Medikamente wechseln, ein um mehr als 30 % höheres Anfallsrisiko haben. Ein solcher Wechsel kann gravierende Folgen haben, sei es im Straßenverkehr, im Berufsalltag oder zu Hause.
Die Gründe für das erhöhte Anfallsrisiko können vielfältig sein, darunter die enge therapeutische Breite der Antiepileptika oder eine verringerte Adhärenz. Schon ein Wechsel in Form oder Farbe der Tabletten kann ebenfalls das Risiko für Nicht-Adhärenz erhöhen. Dies zeigt eine amerikanische Studie mit 60.000 Teilnehmende.
Es ist daher von größter Bedeutung, dass Ärztinnen und Ärzte und ihre Patientinnen und Patienten über die "Aut idem"-Regelung und ihre potenziellen Risiken bei Epilepsie informiert sind. Es ist entscheidend, dass Ärzte und Apotheker zusammenarbeiten, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten und ungewollte Medikamentenwechsel zu vermeiden.
Aut-idem: Ihr Kreuz für Epilepsiepatient*innen
Das „Aut-idem“-Kreuz auf dem Rezept ist bei Patientinnen und Patienten mit Epilepsie besonders wichtig. Warum das so ist, lesen Sie hier.

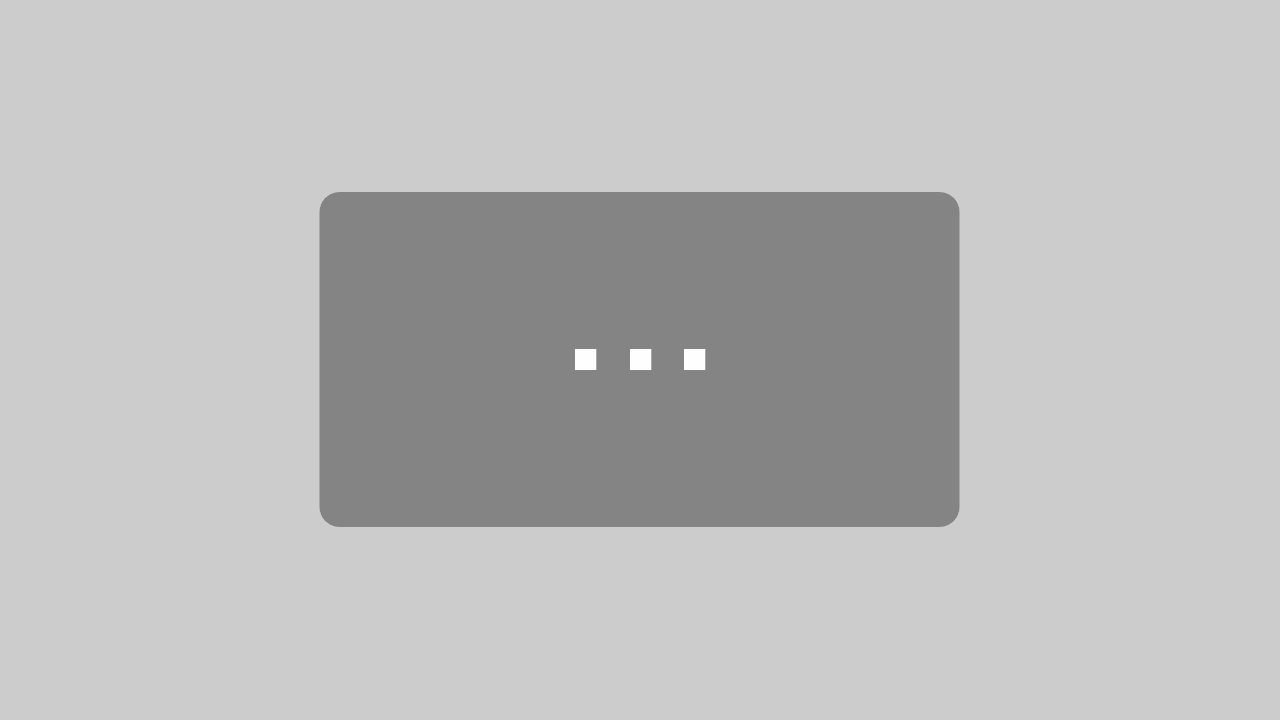
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Wichtiger Hinweis: Wir sind rechtlich dazu verpflichtet, folgende Informationen ausschließlich Ärztinnen und Ärzte bzw. Menschen mit Gesundheitsberufen zur Verfügung zu stellen. Deshalb sind die Fachartikel rund um Epilepsie ausschließlich mit einem Log-in aufrufbar, z. B. via DocCheck.

Ein unterschätztes Antikonvulsivum
In der Ausgabe 4/2021 des Medizinmagazins Forum Sanitas spricht Prof. Dr. med. Gerhard Kurlemann, Neuropädiater und Experte für Epilepsie, über die klinische Anwendung und das Potential des ältesten Antikonvulsivums.

Mit welchem Antikonvulsivum beginnen?
In diesem Podcast geht Herr Prof. Elger auf die unterschiedlichen Patienten-Typen (SANAD-Studie) aller Altersklassen und auch auf die syndromspezifische Behandlung von Kindern ein. Wesentlicher Bestandteil der Therapie ist aber die konzeptionelle Betrachtung des Betroffenen.
Prinzipiell kann jedes Medikament, neben der erhofften Wirkung auch unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen. In den verordneten Mengen haben die meisten Medikamente gegen epileptische Anfälle aber keine oder nur gering ausgeprägte Nebenwirkungen. Dennoch sollte eine medikamentöse Epilepsietherapie, auch bei Anfalls- und Beschwerdefreiheit, regelmäßig ärztlich kontrolliert werden, da manche Medikamente im Dauergebrauch zu Nebenwirkungen führen können. Im Therapieverlauf wird die Epilepsie medikamentös so „eingestellt“, dass das Medikament möglichst nur Wirkungen, aber keine oder nur geringe Nebenwirkungen verursacht.
Gelegentlich können aber auch bei den Mitteln gegen Epilepsie ernstere Nebenwirkungen vorkommen. Vor Beginn einer Behandlung werden Arzt oder Ärztin ausführlich über solche möglichen Nebenwirkungen und ihre frühestmögliche Erkennung aufklären. Erfreulicherweise vertragen die meisten an Epilepsie erkrankten Kinder und Erwachsenen ihre Medikamente jedoch gut. Um auch seltene Nebenwirkungen möglichst rasch zu erkennen, müssen die Patientinnen und Patienten während der gesamten Behandlungsdauer regelmäßig ärztlich überwacht werden. Die Kontrolluntersuchungen werden dabei zu Beginn der Behandlung häufiger sein und nach der sogenannten Einstellungsphase dann seltener. In bestimmten Abständen erfolgen Verträglichkeitsprüfungen der Medikamente in Form von einem Blutbild und einer Prüfung der Leberfunktion vornehmen. Manchmal gehört auch ein Urintest dazu. Ferner kann eine gelegentliche Blutspiegelbestimmung (Plasmakonzentration) der Medikamente dabei helfen, sich zu vergewissern, ob die Dosis ausreicht und ob die Medikamente regelmäßig eingenommen wurden.
Wie bei den meisten Medikamenten gibt es auch bei den Arzneimitteln gegen epileptische Anfälle gelegentlich Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergien), z. B. in Form von Hautausschlägen, Lymphknotenschwellungen und Fieber; in sehr seltenen Fällen können solche allergischen Reaktionen auch einen bedrohlichen Charakter annehmen. Bei einer zu hohen Medikamentengabe kann es zu Überdosierungen kommen, die sich z. B. in Schläfrigkeit, Verstimmungszuständen, Zittern, Sehstörungen oder Gangunsicherheit äußern. Solche Nebenwirkungen lassen sich in aller Regel durch eine Reduzierung der Dosis rasch beheben.
Alle Nebenwirkungen (körperlicher oder psychischer Natur), die Patientinnen und Patienten selbst beobachten, sollten sie sofort den Ärztinnen und Ärzte mitteilen, damit evtl. eine Änderung der Behandlung eingeleitet werden kann. Auf keinen Fall dürfen Patientinnen und Patienten die tägliche Menge der vorgeschriebenen Medikamente eigenmächtig erhöhen oder verringern!
Häufige Nebenwirkungen von Antiepileptika im Überblick:
Die vollständigen Nebenwirkungen zu einem konkreten Antiepileptikum enthält jeweils die aktuelle Gebrauchsinformation.
Auch wenn Antiepileptika von Kindern und Jugendlichen in der Regel gut vertragen werden, muss grundsätzlich auch bei Kindern mit den gleichen Nebenwirkungen der antiepileptischen Therapie, wie bei Erwachsenen gerechnet werden. Allerdings kann es bei Kindern schwieriger sein Nebenwirkungen zu erkennen, gerade dann wenn sie noch sehr klein sind, oder nicht sprechen können. Auch bei Kindern werden Art und Ausmaß der Nebenwirkungen vom jeweiligen Medikament, dessen Dosis, der Kombination mit anderen Medikamenten sowie von der individuellen Verträglichkeit bestimmt.
Der Verdacht auf Nebenwirkungen ist gegeben, wenn sich in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder Umstellung der Therapie Verhaltensänderungen in Form von Verlangsamung und leichter Ermüdung, Überaktivität und Erregbarkeit bis hin zu aggressiv-ungesteuerten Tendenzen ergeben.
Auch Veränderungen des Schulleistungsverhaltens bzw. Verhaltensänderungen im Kindergarten können Hinweise für eine falsche Dosierung oder Unverträglichkeit der Medikamente sein.
Was ist bei der Therapie von Kindern zu beachten?
Sofern Sie eine Nebenwirkung / mangelnde Wirksamkeit festgestellt haben, besprechen Sie dies mit Ihrem/Ihrer Arzt/Ärztin. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Website: www.bfarm.de anzeigen.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Wichtiger Hinweis: Wir sind rechtlich dazu verpflichtet, folgende Informationen ausschließlich Ärztinnen und Ärzte bzw. Menschen mit Gesundheitsberufen zur Verfügung zu stellen. Deshalb sind die Fachartikel rund um Epilepsie ausschließlich mit einem Log-in aufrufbar, z. B. via DocCheck.
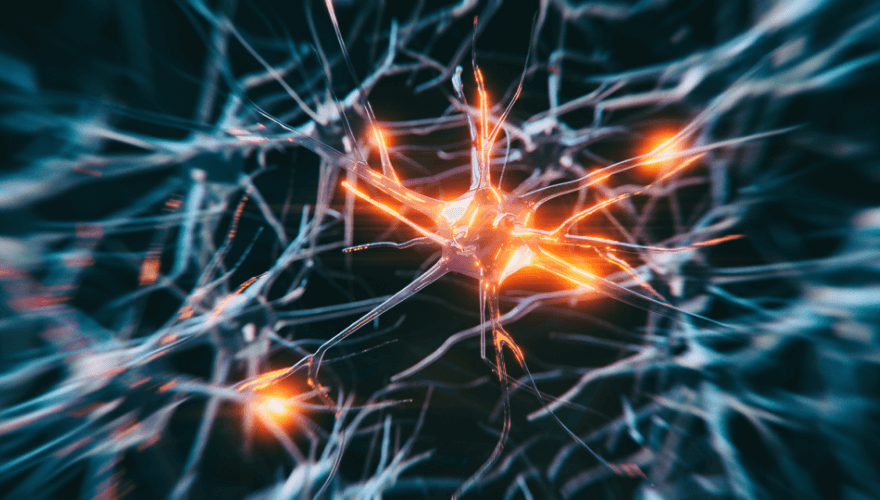
Bewährtes Epilepsiemedikament bleibt Gold-Standard
In den letzten Jahren haben neue Wirkstoffe den Markt erobert. Lesen Sie jetzt, welches Medikament in einer Head-to-Head-Studie seine Vorzüge unter Beweis stellt.

Epilepsie aktuell - Podcast mit Epilepsieexperte Prof. Elger
Wann sprechen wir überhaupt von einer Epilepsie? Wie beginnt man die Therapie? Wann ist ein epileptischer Anfall wirklich ein Notfall? Neurologe, Epileptologe und Seniorprofessor für Kinderepileptologie Prof. Dr. C. E. Elger gibt Ihnen Antworten.
Viele Patientinnen und Patienten haben Bedenken, während der Schwangerschaft Medikamente einzunehmen. Im Idealfall sollten daher bereits vor der Schwangerschaft gemeinsam mit Arzt oder Ärztin die weitere Therapie geplant und alle Risiken, die durch das Medikament eventuell bestehen, abgewogen werden. Unter Umständen besteht die Möglichkeit, die Dosis zu reduzieren oder auf ein anderes Medikament umzusteigen. In seltenen Fällen ist es möglich, das Medikament abzusetzen.
Eine gute Alternative kann sein, zu einem anderen, besser verträglichen Präparat zu wechseln. Tritt eine ungeplante Schwangerschaft ein, sollten behandelnde Ärztinnen und Ärzte möglichst schnell aufgesucht werden, um zu besprechen, wie mit der Medikation weiter verfahren wird. Auf gar keinen Fall sollte das Medikament eigenmächtig abgesetzt werden. Das abrupte Absetzen kann Anfälle hervorrufen, die dem ungeborenen Kind sehr schaden können. Mehr zu diesem Thema finden Sie in der Broschüre „Epilepsie und Schwangerschaft“ und in unserem Podcast mit Prof. Dr. Elger.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
PDF zur Schwangerschaft mit Epilepsie
Wichtige Informationen und Tipps, wenn Sie mit Epilepsie schwanger werden möchten
Autor: Desitin Arzneimittel GmbH
Wichtige Hinweise für Frauen und Mädchen finden Sie hier.
Bestimmte Epilepsie-Formen können operativ behandelt werden. So kann z. B. der Teil im Gehirn, von dem der Anfall ausgeht, entfernt werden, oder man durchtrennt bestimmte Verbindungen im Gehirn, was eine Ausbreitung des epileptischen Anfalls verhindert. Mit speziellen Untersuchungsmethoden stellt man fest, ob Patientinnen und Patienten für eine solche Operation infrage kommt.
Ein epilepsie-chirurgischer Eingriff kommt in der Regel unter folgenden Voraussetzungen in Frage:
Es muss außerdem eine nachgewiesene Pharmakoresistenz vorliegen, die sich wie folgt definiert:
Es versteht sich von selbst, dass ein epilepsie-chirurgischer Eingriff nur nach sehr sorgfältigen Untersuchungen erwogen und vorgenommen werden sollte. Diese Untersuchungen (insbesondere aufwändige EEG-Ableitungen, bildgebende Verfahren) müssen an spezialisierten Zentren durchgeführt werden. Oft ist diese „präoperative Diagnostik“ (Untersuchung vor dem chirurgischen Eingriff) aufwändiger und mitunter belastender als die Operation selbst. Andererseits können gerade in verzweifelten Fällen durch die Epilepsie-Chirurgie oft erstaunlich gute Ergebnisse erzielt werden. Eine Altersbegrenzung nach unten für einen epilepsie-chirurgischen Eingriff gibt es nicht – auch Säuglinge können bereits epilepsie-chirurgisch behandelt werden.
Die Operationsergebnisse scheinen sogar umso günstiger zu sein, je jünger die Patientinnen und Patienten zum Zeitpunkt der Operation sind. Scheuen Sie sich nicht, das Thema „Epilepsie-Chirurgie“ auch von sich aus bei anzusprechen. Bei Patientinnen und Patienten, für die ein epilepsie-chirurgischer Eingriff nicht in Frage kommt, kann die so genannte „Vagusnervstimulation“ erwogen werden. Hier wird mittels operativ eingebrachter Elektroden (im seitlichen Halsbereich links) der Vagusnerv regelmäßig elektrisch gereizt.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Bei kurativen Epilepsie-Operationen wird der Bereich des Gehirns entfernt, von dem die epileptischen Anfälle ausgehen, also das "epileptogene Gewebe", entfernt. Dieser Vorgang wird als "Resektion" bezeichnet. Obwohl dies auf den ersten Blick beunruhigend klingen mag, ist es wichtig zu verstehen, dass dieser Gehirnbereich bei wiederholten Anfällen oft bereits eingeschränkt oder nicht mehr funktionsfähig ist. Das verbleibende gesunde Gehirn kann nach einer erfolgreichen Operation effizienter arbeiten und teils die Aufgaben der entfernten Hirnregion übernehmen. Genau diese Abwägungen werden im Rahmen der ausführlichen Voruntersuchungen gemacht.
Temporal- oder Schläfenlappenepilepsien sind häufige Epilepsiearten, die eine solche Operation ermöglichen. Die genaue Ausdehnung der Resektion, ob umfangreich oder begrenzt, wird durch prächirurgische Bewertungen festgelegt. Ein verbreiteter und bedeutender Eingriff bei Erwachsenen ist die selektive Amygdala-Hippokampektomie (SAH). Hierbei werden spezifisch die epileptogenen Teile des betroffenen Schläfenlappens, wie der Hippokampus und die Amygdala, entfernt. Manchmal umfasst die Resektion auch den vorderen Teil des Schläfenlappens. Nach solchen Eingriffen haben Patientinnen und Patienten mit Temporallappenepilepsie eine Chance von 60-80 % anfallsfrei zu werden.
Unter "extratemporalen Resektionen" versteht man das Entfernen eines epileptogenen Bereichs außerhalb des Temporallappens. Ursachen können verschiedene Gehirnanomalien sein, wie fokale kortikale Dysplasien, gutartige Tumoren oder Gefäßanomalien. Die Wahrscheinlichkeit, nach solchen Eingriffen anfallsfrei zu werden, kann variieren, je nachdem, wo sich der epileptogene Fokus genau befindet.
Unter dem Begriff "Diskonnektion" versteht man das Durchtrennen oder Unterbrechen von Verbindungen, und bei diesen chirurgischen Eingriffen geht es genau darum: das Durchtrennen von Faserverbindungen im Gehirn. Diese Operationen sind in der Regel palliative Maßnahmen, die zur Linderung bei besonders schweren Epilepsieformen eingesetzt werden.
Ein Beispiel dafür ist die Kallosotomie, bei der die Verbindungen zwischen den beiden Großhirnhälften, dem sogenannten "Corpus callosum", entweder komplett oder teilweise durchtrennt werden. Dieser Eingriff wird vor allem bei Patientinnen und Patienten mit häufigen schweren Sturzanfällen angewendet, die nicht auf andere Weise operativ behandelt werden können. Durch das Durchtrennen dieser Verbindungen können sich Anfälle nicht mehr im gesamten Gehirn ausbreiten. Aufgrund der damit verbundenen Risiken ist eine umfassende Diagnostik vor dem Eingriff unerlässlich.
Ein weiteres palliatives Verfahren ist die multiple subpiale Transsektion (MST). Hierbei durchtrennt der Chirurg mehrere Nervenbahnen direkt unter der Hirnrinde in regelmäßigen Abständen. Diese Methode kann die Ausbreitung von Anfällen verhindern und gleichzeitig die Hauptfunktionen des Gehirns weitestgehend erhalten. Daher kann sie auch in besonders wichtigen Gehirnregionen durchgeführt werden.
Die Hemisphärotomie bezeichnet das funktionelle Abtrennen einer gesamten Gehirnhälfte. Bei diesem Eingriff werden die Verbindungen der betroffenen Hirnhälfte zur anderen Seite und zu tiefer liegenden Hirnstrukturen durchtrennt. Dieser heilende Eingriff, der eine über 80%ige Chance auf Anfallsfreiheit bietet, wird hauptsächlich bei Kindern angewendet. Er wird bei schweren Epilepsieformen eingesetzt, die eine ganze Gehirnhälfte betreffen, wie z.B. bei der Rasmussen-Enzephalitis oder dem Sturge-Weber-Syndrom. Oft zeigt sich, dass das Gehirn "anpassungsfähig" ist und die verbleibende Hirnhälfte die Funktionen der entfernten übernehmen kann."
Wenn nach einer gründlichen Untersuchung eine resektive Operation nicht möglich ist oder nicht den gewünschten Erfolg bringt, können elektrische Stimulationsmethoden helfen, die Anfallshäufigkeit zu reduzieren. Bei diesen Verfahren senden sogenannte "Hirnschrittmacher" elektrische Signale über spezielle Elektroden direkt ins Gehirn, um epileptische Aktivitäten zu unterdrücken. Zwei gängige Ansätze sind die Vagusnervstimulation und die Tiefe Hirnstimulation. Beide Verfahren sind jedoch palliativ, was bedeutet, dass sie die Epilepsie verbessern, aber selten vollständig heilen (< 5 % der Fälle).
Vagusnervstimulation (VNS): Der Vagusnerv, auch als zehnter Hirnnerv bekannt, verläuft aus unserem Schädel heraus. Bei der VNS wird ein batteriebetriebenes Gerät, ähnlich einem Herzschrittmacher, unter der Haut nahe dem Schlüsselbein eingesetzt und mit einer Elektrode am Hals verbunden, die den Vagusnerv umschließt. Dieses Verfahren, das seit den 1990er Jahren bei über 100.000 Menschen angewendet wurde, sendet schwache Impulse, die andere Organe nicht beeinträchtigen. Diese Impulse sollen die epileptische Aktivität im Gehirn reduzieren. Mehrere Studien, zum Beispiel eine retroperspektive Studie des Department of Neurology der New York University am Langone Medical Center, USA aus dem Jahr 2011 und eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigen bei über der Hälfte der Patientinnen und Patienten eine Halbierung ihrer Anfälle. VNS kann auch die Stimmung verbessern und bei einigen Patienten die kognitive Funktion steigern.
Tiefe Hirnstimulation (DBS): Die DBS, die bereits erfolgreich bei Erkrankungen wie Parkinson eingesetzt wurde, wird nach und nach auch für die Behandlung von Epilepsie getestet, ist allerdings noch nicht so gut erforscht wie die VNS und deshalb in Deutschland nicht weit verbreitet. Im Rahmen der DBS werden feine Elektroden präzise ins Gehirn eingebracht, um spezifische Bereiche, oft den Thalamus, zu stimulieren. Ein unter der Haut implantiertes Gerät erzeugt die elektrischen Impulse. Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören Schlafprobleme, Gedächtnisschwierigkeiten und Stimmungsschwankungen.
Bevor jemand eine Epilepsie-Operation in Erwägung zieht, ist eine gründliche Untersuchung in spezialisierten Zentren erforderlich. Ziel ist es herauszufinden, ob die epileptischen Anfälle von einem bestimmten Gehirnbereich ausgehen und ob dieser sicher entfernt werden kann. Dabei wird auch geprüft, ob nach der Operation wichtige Funktionen wie Gedächtnis, Sprache oder Kraft beeinträchtigt werden könnten.
Der Prozess beginnt mit einer medizinischen und neurologischen Untersuchung, gefolgt von neuropsychologischen Tests und Gesprächen mit dem Sozialdienst. Dies hilft zu verstehen, wie sich das Leben nach der Operation verändern könnte. Durch verschiedene Aufgaben analysieren Neuropsycholog*innen, inwiefern die Epilepsie Aspekte wie Sprache, Gedächtnis oder Aufmerksamkeit beeinflusst. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf den betroffenen Gehirnbereich. Zudem kann vorhergesagt werden, ob die Operation möglicherweise diese Funktionen beeinflussen würde. In einigen Fällen zeigt sich, dass andere Gehirnbereiche bereits wichtige Funktionen übernommen haben, was als "plastische Verlagerung eloquenter Areale" bezeichnet wird.
In manchen Situationen kann es notwendig sein, invasive neuropsychologische Tests durchzuführen, insbesondere wenn andere Untersuchungen keine klaren Ergebnisse liefern. Ein solcher Test ist der Wada-Test, benannt nach dem Neurologen Juhn Atsushi Wada. Hierbei wird ein kurz wirkendes Beruhigungsmittel in die Adern gespritzt, wodurch ein Teil des Gehirns kurzzeitig betäubt wird. Anschließende Tests zeigen, welche kognitiven Fähigkeiten in diesem Zustand beeinträchtigt sind. In Kombination mit nicht-invasiven Methoden kann oft das Risiko des geplanten chirurgischen Eingriffs besser bewertet werden.
Weiterhin prüft eine psychiatrische Untersuchung mögliche psychische Auswirkungen durch die Operation. Ein MRT des Gehirns gibt detaillierte Bilder des Gehirns, und ein Video-EEG-Monitoring zeichnet die Anfälle und Gehirnaktivitäten auf.
Nachdem alle Daten gesammelt wurden, diskutiert ein Expertenteam die Ergebnisse und berät über die möglichen Vorteile und Risiken einer Operation. Schließlich entscheidet der Patient über das weitere Vorgehen. Es gibt verschiedene Optionen, je nach Ergebnis: Manchmal ist eine Operation nicht möglich, manchmal ist sie der beste Weg. Jeder Schritt wird sorgfältig mit dem Patienten besprochen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Bei etwa 10%-20% unserer Patientinnen und Patienten ist es notwendig, Elektroden chirurgisch einzusetzen. Dieser Schritt wird unternommen, wenn herkömmliche Untersuchungen den Ursprung der Epilepsie nicht genau bestimmen oder ihn von wichtigen Gehirnregionen unterscheiden können. Besonders wenn im MRT keine auffälligen Veränderungen sichtbar sind, kann diese Methode sehr hilfreich sein.
Subdurale Elektroden, die direkt unter der Hirnhaut positioniert werden, sind oft in Form von Streifen oder Gittern angeordnet. Für ihre Platzierung wird ein individueller Plan erstellt. Wenn die epileptischen Anfälle nicht an der Oberfläche des Gehirns auftreten, müssen spezielle Tiefenelektroden eingesetzt werden. Bei jedem dieser Eingriffe werden die Patientinnen und Patienten vollständig betäubt. Die Dauer des Eingriffs variiert je nach Anzahl der zu implantierenden Elektroden.
Ziel der Behandlung ist die Anfallsfreiheit. Bei richtiger Anwendung der heute zur Verfügung stehenden Mittel sehen die statistisch ermittelten durchschnittlich erreichten Behandlungsergebnisse folgendermaßen aus:
Von jeweils zehn Patientinnen und Patienten...
In den letzten Jahren ist das Wissen über epileptische Anfälle und Epilepsien deutlich angewachsen, so sind auch neue Medikamente gefunden bzw. gezielt entwickelt worden. Es ist davon auszugehen, dass es auch in den nächsten Jahren gelingen wird, die Erkenntnisse über Epilepsien zu erweitern und bessere Medikamente zu entwickeln. So dürfen auch diejenigen hoffen, denen bis heute noch nicht oder nur ungenügend geholfen werden kann. Hinzu kommt, dass von den Patientinnen und Patienten, bei denen mit Medikamenten keine befriedigende Hilfe möglich ist, heute bereits knapp 10 % einem epilepsie-chirurgischen Eingriff zugeführt werden können; die Erfolgsaussichten eines solchen Eingriffs liegen dabei – je nach Epilepsieform und Operationsverfahren – zwischen 50-80 %.
Die weit überwiegende Zahl von Epilepsiepatient*innen wird medikamentös behandelt. Bei ca. 60-70 % wird damit eine befriedigende Anfallskontrolle erzielt. Ca. 50 % der Patientinnen und Patienten werden anfallsfrei. Diese Häufigkeiten sind jedoch je nach Art der Epilepsie sehr unterschiedlich.
Immer wieder ist auch die ketogene Diät im Zusammenhang mit Epilepsie Thema.
Die Ernährung von Epilepsiepatient*innen sollte sich nicht von einer normalen, gesunden Ernährung unterscheiden. Es sind keine Nahrungsmittel bekannt, die Anfälle auslösen oder die Neigung zu Anfällen fördern; umgekehrt können Diätvorschriften das Auftreten von epileptischen Anfällen nicht verhindern.
Eine Ausnahme stellt die sogenannte ketogene Diät dar, bei der mit einer besonders fettreichen Kost eine anfallshemmende Übersäuerung des Blutes erreicht werden soll. Die Ketogene Diät ist eine Ernährungsform, bei der fast komplett auf Kohlenhydrate (Brot, Nudeln etc.) verzichtet wird. Dadurch soll der Körper gezwungen werden, die benötigte Energie aus den Fettdepots zu ziehen.
Im Hungerzustand greift der Körper zunächst auf seine Glykogenvorräte (Speicherform der Kohlenhydrate in der Leber) zurück und stellt sich im weiteren Verlauf zunehmend auf einen Hungerstoffwechsel um. Das bedeutet allerdings nicht, das der/die Patient*in bei der Diätform Hunger leidet. Diese Art des Stoffwechsels ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass die aus der Nahrung stammenden Fettsäuren in der Leber zu Ketonkörpern abgebaut werden, die dann an Stelle der Zucker (Glucose) den Energiebedarf, vor allem den Energiebedarf des Gehirns, auf alternative Weise effizient decken sollen. Dieser angestrebte Stoffwechsel-Zustand heißt Ketose.
Ketonkörper sind energiehaltiger und brennen langsamer als Glukose aus Kohlenhydraten. Nicht selten tritt ein Epilepsieanfall als Folge einer Unterzuckerung im Gehirn ein. Sind Ketonkörper vorhanden, dauert der Prozess bis zur Unterzuckerung sehr viel länger. Dadurch ist genug Zeit vorhanden, dass sie natürlich kompensiert werden kann und ein Epilepsieanfall bleibt aus.4
Bei der ketogenen Diät, die zu den Low-Carb-Diäten gehört, wird auf folgende Lebensmittel größtenteils verzichtet:
In ausgewählten Fällen kann diese aufwändige und nebenwirkungsfreie Behandlung gerade im Kindesalter bei Epilepsien Hilfe bringen, die auf Medikamente nicht oder ungenügend ansprechen und einem epilepsie-chirurgischen Eingriff nicht zugänglich sind. Das kann z. B. beim West-Syndrom (BNS-Epilepsie) der Fall sein. Dabei handelt es sich um eine seltene, sehr ernstzunehmende Säuglings-Epilepsie. Ursache sind beispielsweise Fehlbildungen oder Schäden des Gehirns, Infektionen bzw. Stoffwechselstörungen. Sprechen die Betroffenen in einem solchen Fall nicht auf die Medikamente an, kann unter Umständen eine ketogene Diät helfen. Diese sollte aber nur in Zusammenarbeit mit erfahrenen Ärztinnen und Ärzte (möglichst mit Unterstützung von Diätassistent*innen) Anwendung finden.
Der Glukosetransporter(GLUT1)-Defekt – kurz GLUT1-Defekt – ist eine Erkrankung des zerebralen Energiestoffwechsels, die bei Nicht- oder Fehlbehandlung zu schwerer geistiger und körperlicher Behinderung führt. Auch für die Behandlung des GLUT1-Defektes ist die ketogene Diät Therapie der Wahl; für an Epilepsie Erkrankte ist sie dann eine Chance, wenn zahlreiche Medikamente erfolglos ausprobiert wurden und die Epilepsie-Chirurgie nicht helfen kann.
Wichtiger Hinweis: Wir sind rechtlich dazu verpflichtet, folgende Informationen ausschließlich Ärztinnen und Ärzte bzw. Menschen mit Gesundheitsberufen zur Verfügung zu stellen. Deshalb sind die Fachartikel rund um Epilepsie ausschließlich mit einem Log-in aufrufbar, z. B. via DocCheck.

Ketogene Diät bei Epilepsien und Prinzipien der Epilepsiechirurgie
Die Expertin Fr. Dr. Makowski erläutert anhand aktueller Studiendaten, Leitlinienempfehlungen sowie an Fallbeispielen die Effektivität der Diät bei unterschiedlichen Epilepsieformen. Hr. PD Dr. Dr. Vollmar informiert über Prinzipien und Praxis der Epilepsiechirurgie.

Prof. Elger: Die Sinnhaftigkeit nicht-medikamentöser Therapien
Welche Vorgehensweise wird empfohlen, wenn mit Hilfe einer medikamentösen Therapie keine Anfallsfreiheit bei Epilepsie-Patientinnen und Patienten erreicht werden kann? Experte Prof. Elger erläutert in dieser Podcast-Folge, wann eine nicht-medikamentöse Behandlung erfolgen sollte.
Die Prognose bezieht sich in den folgenden Absätzen und der Tabelle primär auf das Erreichen von Anfallsfreiheit. Bei den Epilepsiesyndromen kann es - neben den Anfällen - auch andere Beeinträchtigungen geben, vor allem in der körperlichen und geistigen Entwicklung. Auch diese fließen, je nach Epilepsiesyndrom, in die Beurteilung der Prognose ein. Diese Syndrome haben in der Regel eine schlechtere Prognose, weil Anfallsfreiheit seltener erreicht wird. Und wird sie erreicht, bleiben andere Symptome in der Regel trotzdem bestehen.
Es gibt einen großen Unterschied bezüglich günstiger oder ungünstiger Prognose, je nachdem ob es sich um eine idiopathische generalisierte Epilepsie handelt (also vermutlich mit genetischer Ursache), wie etwa die Pyknolepsie, Juvenile Absence Epilepsie und die Aufwach-Grand-Mal, oder um eine strukturelle und generalisierte Epilepsie unbekannter Ursache, wie etwa das West-Syndrom oder das Lennox-Gastaut-Syndrom.
Das Ziel der Behandlung ist wie gesagt die Anfallsfreiheit. Zwar kann diese auch bei generalisierten Epilepsien erreicht werden, doch ist im Vergleich zu rein fokalen Epilepsien die Prognose etwas schlechter. Die Behandlung einer fokalen Epilepsie mit Antiepileptika führt bei etwa 60 bis 70 Prozent der Betroffenen zur Anfallsfreiheit.1,2,3 Natürlich gibt es aber auch hier bei einzelnen Epilepsie-Formen bzw. Syndromen Abweichungen. In der Tabelle werden deshalb nur die bekanntesten Abweichungen aufgegriffen. Bei einer Pharmakoresistenz, also wenn die medikamentöse Therapie nicht wirkt und nicht zur Anfallsfreiheit führt, kann bei fokalen Epilepsien ein chirurgischer Eingriff in Erwägung gezogen werden.
| Epilepsie-Form / Syndrom | Prognose für vollständige Anfallsfreiheit |
|---|---|
| Aufwach-Grand-Mal Epilepsie | Die Prognose bzgl. Anfallsfreiheit während der Behandlung mit Antiepileptika ist gut, jedoch ist die Rückfallquote nach dem Absetzen der Medikamente hoch.5 |
| BNS-Epilepsie / West-Syndrom | Das West-Syndrom beginnt im ersten Lebensjahr und wird durch sog. "Blitz-Nick-Salaam-Anfälle" geprägt. Trotz sofortiger Einleitung der Therapie nach der Dignose, ist eine vollständige Anfallsfreiheit nur schwer zu erreichen. Auch Spontanheilungen sind selten. Häufig kommt es trotz Behandlung zu körperlichen und kognitiven Defiziten.6 |
| Dravet-Syndrom | Häufig trotz Therapie keine Anfallsfreiheit.7 Darüber hinaus geht die Erkrankung mit einer Entwicklungsverzögerung einher. Allerdings sind auch Fälle mit günstigerem Verlauf beschrieben. |
| Juvenile Absence Epilepsie (JAE) | Die Prognose variiert je nach Art der auftretenden Anfälle. Bei ca. 80% der Betroffenen spricht die JAE gut auf die antikonvulsive Behandlung an.8 Die Prognose bzgl. vollständiger Anfallsfreiheit ist jedoch schlechter als bei der Pyknolepsie. Treten häufig generalisierte tonisch-klonische Anfälle auf, ist die Prognose besonders ungünstig. |
| Juvenile myoklonische Epilepsie | Beginn mit kurzen Myoklonien ("Zuckungen") in Schultern Armen und Händen, die bei fast allen Patienten im Verlauf der Erkrankung in generalisierte tonisch-klonische Anfälle übergehen können. Sehr gute Prognose bei lebenslanger Therapie Anfallsfreiheit zu erreichen.5 |
| Lennox-Gastaut-Syndrom | Tonische- und Sturzanfälle sind typisch, sowie eine intellektuelle Beeinträchtigung der Patienten. In fast allen Fällen erweist sich das Lennox-Gastaut-Syndrom als therapieresistent.5,6 |
| Myoklonisch-astatische Epilepsie (Doose-Syndrom) | Seltene Form der frühkindlichen Epilepsie (beginnt im Alter zwischen 1 -5 Jahre), mit sehr variabler Prognose, bei leicht negativer Tendenz.5,6 Verschiedene Anfallsformen in unterschiedlicher Intensität sind mehrmals täglich möglich. Entweder verkrampfen die Muskeln (myoklonisch), oder sie erschlaffen (astatisch). Auch Absencen sind möglich. Typisch sind Sturzanfälle oder das Zusammensacken des Körpers. Gelingt es frühzeitig, die Erkrankung in den Griff zu bekommen und eine Anfallsfreiheit zu erreichen, ist die Prognose bzgl. geistiger und psychomotorischer Entwicklung in der Hälfte der Fälle gut.9 Das gelingt jedoch nicht immer. In einigen Fällen spricht das Doose-Syndrom nicht ausreichend auf die Medikamente an, oder die Anfälle verstärken sich sogar, was bei weiterhin ausbleibendem Behandlungserfolg zu einer Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung führen kann. |
| Pyknolepsie | Die sog. Absenceepilepsie des Kindesalters ist mit Valproinsäure, Lamotrigin oder Ethosuximid sehr gut behandelbar, bei normaler Entwicklung. Etwa 90 Prozent der Kinder werden anfallsfrei.6 |
Fortbildungen für Fachkreise
Fortbildungen aus den Bereichen Neurologie, Neuropädiatrie und Seltene Erkrankungen


Was Sie unbedingt über SUDEP wissen sollten
SUDEP – der plötzliche Tod durch Epilepsie und was Sie darüber wissen sollten Das Wichtigste im Überblick Was bedeutet SUDEP? SUDEP ist die Abkürzung für […]
Die wesentlichste Hilfe, die Eltern oder Angehörige ihren epilepsiekranken Kindern oder Partner*innen geben können, besteht zunächst darin, dass sie die Patientinnen und Patienten und ihre Epilepsie annehmen. Das gilt auch für die Patientinnen und Patienten selbst. Dies bedeutet aber keineswegs Resignation, sondern vielmehr die Aufforderung, zusammen mit den Ärztinnen und Ärzte nach den bestmöglichen Hilfen für den/die Patient*in zu suchen.
Auf folgende Punkte sollten Betroffene und Angehörige während der Behandlung besonders achten:
Viele Patientinnen und Patienten werden durch die Medikamenteneinnahme anfallsfrei. Dafür müssen die Medikamente über Jahre hinweg eingenommen werden. Bei meist guter Verträglichkeit und jahrelanger Anfallsfreiheit fällt es oft schwer, jeden Tag an die Einnahme der Tabletten zu denken. Schließlich geht es einem ja „gut“. Trotzdem ist es notwendig, die Medikamente regelmäßig einzunehmen, um den notwendigen Medikamentenspiegel im Blut weiter aufrechtzuerhalten und die Anfallsfreiheit oder eine niedrige Anfallsfrequenz zu sichern. Unter bestimmten Umständen kann es möglich sein, die Medikamente abzusetzen. Dies sollte immer gemeinsam mit Arzt oder Ärztin besprochen und entschieden werden. In keinem Fall sollten Patientinnen und Patienten selbst Ihre Medikamente absetzen. Unabhängig davon ist es auch im Verlauf der Therapie sehr wichtig, dass Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte im Gespräch bleiben und aufkommende Fragen und Bedenken mit ihm/ihr offen besprechen.
Ob das Absetzen der Medikamente möglich ist oder nicht, lässt sich nicht vorhersagen. Die Prognose variiert von Einzelfall zu Einzelfall. Ärztinnen und Ärzte können nur auf Basis der jeweiligen Situation grob einschätzen, wie hoch das Anfallsrisiko ohne Medikamente ist. Es ist deshalb auch nicht selten, dass Epilepsiepatient*innen sich nach der Diagnose darauf einstellen müssen, dass sie die Medikamente ein Leben lang einnehmen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein permanenter Hirnschaden Ursache der epileptischen Anfälle ist.
Für Sie als Patient*in ist es wichtig, gut über Ihre Erkrankung und die Behandlung Bescheid zu wissen. Erster Ansprechpartner sollten immer die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sein. Klären Sie mit ihm/ihr alle Fragen, die Sie beschäftigen.
Dies kann zum Beispiel sein:
Es ist menschlich, einmal eine Medikamenteneinnahme zu vergessen. Doch was tun in solch einem Fall? Viele Medikamente haben eine ausreichend lange Halbwertszeit, die einen gewissen Schutz bietet. Dennoch sollte eine vergessene Dosis nachgeholt werden. Bei Unsicherheiten ist es immer ratsam, Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzte zu halten.
Damit dies nicht geschieht, gibt es ein paar einfache Tipps und Tricks:
Neben der regelmäßigen Einnahme der Medikamente, oder wenn diese nicht ausreichend wirken, gibt es noch weitere Methoden, um das Anfallsgeschehen zu reduzieren und ein besseres Verständnis bezüglich der eigenen Anfälle zu erlangen, und somit mehr Kontrolle über die Epilepsie. Dies trägt meist erheblich zur Verbesserung der Lebensqualität von Epilepsie-Patientinnen und Patienten bei und wird zudem von den meisten Krankenkassen bezahlt. Im Rahmen der Psychotherapie lernen Patientinnen und Patienten dabei, mit den Symptomen umzugehen und sogar gezielt gegenzusteuern.
Mit der Anfallskontrolle können Betroffene lernen, ihre Gesundheit aktiv zu fördern, ihre Ängste zu überwinden und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Es geht darum, sich selbst besser zu verstehen, die eigenen Anfälle zu analysieren und Strategien zu entwickeln, um sie zu vermeiden. Es ist ein Weg, die Kontrolle über die Epilepsie zurückzugewinnen und ein freieres Leben zu führen.
Die Anfallsselbstkontrolle hilft, die eigene Aufmerksamkeit zu schärfen, die Ursachen der Anfälle zu erkennen und besser mit dem Anfallsrisiko umzugehen. Es geht darum, die Warnzeichen eines Anfalls zu erkennen und zu lernen, wie man ihn abwehren kann.
Viele Menschen mit Epilepsie fühlen sich oft hilflos und denken, dass ihre Anfälle zufällig auftreten. Aber wenn man genauer hinschaut, kann man oft Muster erkennen. Es gibt bestimmte Situationen, in denen Anfälle häufiger auftreten, und andere, in denen sie seltener sind. Indem man diese Muster erkennt und versteht, welche Faktoren die Anfälle fördern, kann man Strategien entwickeln, um sie zu vermeiden. Es ist nicht immer leicht, diese Faktoren zu erkennen, aber mit Unterstützung und Geduld kann es gelingen. Das Ziel ist nicht, alles zu vermeiden, was einen Anfall auslösen könnte, sondern einen guten Umgang damit zu finden.
Tipps zur Anfallskontrolle:
Ein weiterer Ansatz ist die Anfallsabwehr durch Auraunterbrechung. Ein epileptischer Anfall entsteht, wenn das Gehirn kurzzeitig die Kontrolle über die Erregungsprozesse in den Nervenzellen verliert. Bei einigen Menschen kündigt sich ein solcher Anfall durch eine Aura an, eine Veränderung in der Wahrnehmung oder im Verhalten. Indem man diese Aura frühzeitig erkennt und Strategien entwickelt, um sie zu unterbrechen, kann man den Anfall oft verhindern oder abmildern.
Wenn Patientinnen und Patienten spüren, dass sich ein Anfall durch eine Aura angekündigt, können sie dieser gezielt entgegenwirken. Eine Aura wirkt sich häufig auf die psychische Ebene und Gefühlsebene aus, oder kann sich durch optische, akustische oder anderweitige sensorische Halluzinationen bemerkbar machen. Einem Kribbeln kann man mit dem Reiben der Stelle etwas entgegensetzen. Einem seltsamen Geschmack im Mund kann durch etwas Salz oder Knoblauch auf der Zunge begegnet werden. Nehmen Patientinnen und Patienten plötzlich Geräusche wahr, können Sie mit Musik gegensteuern. Wirkt sich die Aura auf die Gefühlsebene aus (Angst, veränderte Zeitwahrnehmung, unangenehmes Gefühl in der Magengegend) können Beruhigungstechniken und emotionale Bewältigungsstrategien helfen, die man im Rahmen der Psychotherapie erlernt. Diese Techniken können teilweise die Ausbreitung der Anfallsaktivität im Gehirn verhindern.
Keine dieser Methoden funktioniert jedoch für sich allein und bei allen Patientinnen und Patienten gleichermaßen. Entscheidend ist, dass sie eine Ergänzung zur Gabe der Antiepileptika darstellen und diese nicht ersetzen. Zudem zeichnet sich eine Epilepsie eben dadurch aus, dass Anfälle eben plötzlich und nicht-provoziert auftreten. Nicht bei jedem Patientinnen und Patienten gibt es also bestimmte Trigger, die man meiden, oder Auren, die man unterbrechen kann.
Das Fundament jeder erfolgreichen Behandlung ist das gegenseitige Vertrauen zwischen Ärztinnen und Ärzte und ihren Patientinnen und Patienten. Besonders bei Jugendlichen mit Epilepsie kann die Annahme von Ratschlägen als Bevormundung empfunden werden. Es ist daher essentiell, dass beide Seiten ein tiefes Verständnis und Respekt füreinander entwickeln. Nur so kann eine optimale Behandlung und Lebensqualität erreicht werden.
Was Ärztinnen und Ärzte von ihren Patientinnen und Patienten erwarten:
Was Patientinnen und Patienten von ihren Ärztinnen und Ärzte erwarten:
Tabelle:
| Erwartungen | Ärztinnen und Ärzte | Patientinnen und Patienten |
|---|---|---|
| Kommunikation | Klare und präzise Informationen | Offene Fragen und Feedback |
| Verständnis | Zeit für Betroffene und Angehörige nehmen | Aktives Zuhören |
| Vertrauen | Empathie und Respekt zeigen | Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit |
Adhärenz oder Compliance ist ein Schlüsselbegriff in der Behandlung von Epilepsie. Es beschreibt, wie genau Patientinnen und Patienten den ärztlichen Ratschlägen und Empfehlungen folgen. Eine hohe Adhärenz ist oft ein Indikator für eine erfolgreiche Behandlung. Doch es geht nicht nur um die Medikamenteneinnahme, sondern auch um die allgemeine Lebensführung, zum Beispiel die Schlafgewohnheiten, Stressreduktion oder Alkoholkonsum.
Tipps für eine bessere Adhärenz:
Wichtiger Hinweis: Wir sind rechtlich dazu verpflichtet, folgende Informationen ausschließlich Ärztinnen und Ärzte bzw. Menschen mit Gesundheitsberufen zur Verfügung zu stellen. Deshalb sind die Fachartikel rund um Epilepsie ausschließlich mit einem Log-in aufrufbar, z. B. via DocCheck.

Tablettenschlucken leichtgemacht
Studien zeigen, dass die Darreichungsform eines Medikamentes eng mit der Compliance der Patientinnen und Patienten verknüpft ist. Eine Umfrage mit über 1000 Patientinnen und Patienten in allgemeinmedizinischen Praxen Süd-West-Deutschlands ergab, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die Probleme bei der Einnahme von Tabletten haben, deswegen weniger als die verordnete Menge einnimmt.

In dieser Fortbildung erläutert Ihnen die Expertin Dr. med. Judith Osseforth, wie eine medikamentöse Therapie speziell bei älteren Epilepsie-Patientinnen und Patienten erfolgen kann, auf welche Aspekte dabei geachtet werden sollte (z. B. Komedikationen, Pharmakodynamik, medikamentöse Darreichungsformen) und welche weiteren unterstützenden Maßnahmen bei der Behandlung zur Verfügung stehen.

Tipps für den Alltag mit Epilepsie Kurzzusammenfassung Viele Patienten sind nach der ersten Diagnose verunsichert, wie sich ihr gewohntes Leben nach der Diagnose Epilepsie verändern […]
Das Desitin Redaktionsteam besteht aus den Bereichen Medical Affairs und Product Management. Um Ihnen die besten Inhalte zu bieten, arbeiten wir zusätzlich mit Expertinnen und Experten zusammen. Das Team wird um ausgewählte Ärztinnen und Ärzte sowie Fachjournalistinnen und Fachjournalisten ergänzt. Diese schreiben regelmäßig für uns und bereichern desitin.de mit ihren fachlichen Beiträgen. Schreiben Sie uns bei Fragen auch gerne eine E-Mail an info@desitin.de.
1 Sander JW et al. National General Practice Study of Epilepsy: newly diagnosed epileptic seizures in a general population. Lancet 1990;336(8726):1267-1271. doi:10.1016/0140-6736(90)92959-l.
2 Brandt, C.: Akut-symptomatische epileptische Anfälle: Inzidenz, Prognose und Aspekte der antiepileptischen Behandlung. Aktuelle Neurologie 2012, 480-485
3 Amboss. Generalisierte Epilepsien im Kindesalter. Online verfügbar unter: https://www.amboss.com/de/wissen/Fokale_Epilepsien_und_Syndrome. Zuletzt abgerufen: April 2021.
4 Christian Floto, Michael Ristow: Low-Carb – Weniger Kohlenhydrate, bessere Gesundheit? Deutschlandfunk – „Sprechstunde“', 6. September 2016
5 Neubauer et al. Epilepsie im Kindes- und Jugendalter. cme.aerzteblatt.de/kompakt. 2007.
6 Sälke-Kellermann: Prognose der Epilepsien im Kindesalter. Pädiatrie 3/04: 9-12. 2004.
7 Dravet, C., Bureau, M., Oguni, H., Fukuyama, Y., Cokar, O.: Severe myoclou0002nic epilepsy in infancy: Dravet syndrome. Adv Neurol 2005; 95: 71–102
8 Neurologienetz. Juvenile Absenceepilepsie (ICD-10 G40.3). Online verfügbar unter: https://www.neurologienetz.de/fachliches/erkrankungen/epilepsien/juvenile-absencen-epilepsie-nicht-pyknoleptische-absencen/. Zuletzt abgerufen: November 2021.
9 Neubauer, B. A., Hahn, A., Doose, H., Tuxhorn, I.: Myoclonic-astatic epilepsy of early childhood – definition, course, nosography, and genetics. Adv Neurol 2005; 95: 147–55.
Mehr für Epilepsie-Patientinnen und Patienten
Um Ihnen den Alltag als Patient*in bzw. Angehörige*r zu erleichtern,
bieten wir Ihnen umfangreiche Informationen.
INFOMATERIAL
Broschüren & Downloads
PRODUKTE
Übersicht & Informationen
ZENTREN FINDER
Hilfe in Ihrer Nähe
TIPPS
Für den Alltag